„Wer Deutschland regieren will, muß es sich erobern“
Das Kaiserreich als monarchisches Projekt Wilhelms I.
Jan Markert
„Unsere Generation erscheint mir wie die Märtyrer Generation“, klagte Prinz Wilhelm von Preußen (1797–1888) gegenüber seiner Schwester 1831, „wir sollen Alles durchmachen; vielleicht viele Umstellungen in der Welt und menschlichen Gesellschaft erleben, die […] einst zum Heil der Menschen ausschlagen sollen, – von welchem Heil ich jedoch jetzt nichts ahnden kann […].“[1]
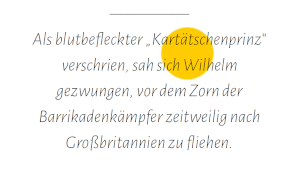
Wie viele seiner Standesgenossen des „langen 19. Jahrhunderts“ blickte der spätere erste Deutsche Kaiser mit Sorge und Skepsis in die Zukunft. Die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche, die Europa nach der Französischen Revolution prägen sollten, stellten die gekrönten Häupter des Kontinents vor bis dato ungekannte Herausforderungen. Die traditionell auf dem Gottesgnadentum fußende monarchische Herrschaftsordnung musste nach neuen Legitimierungsstrategien, neuen systemstützenden Fundamenten suchen, wollte sie nicht Gefahr laufen, einer revolutionären Entwicklung zum Opfer zu fallen. Diese Epoche der Neuerfindung der Monarchie erlebte Wilhelm I. nicht nur aus erster Nähe mit. Er spielte auch eine aktive, ja teils entscheidende Rolle im Transformationsprozess, den die Hohenzollernmonarchie nach der Märzrevolution 1848 durchlief.
Zeit seines Lebens und seiner Herrschaft verfolgte er das Ziel, die dominierende Position der preußischen Krone gegen die revolutionäre Bedrohung insbesondere der Demokratie- und Nationalbewegung zu verteidigen. Übertragen auf Wilhelms politische Biografie können innerhalb dieser monarchischen Agenda drei grundlegende Phasen differenziert werden: Eine reaktionäre Phase vor 1848, während der er politischen Reformen der absolutistischen Hohenzollernmonarchie und jeglicher Änderung des 1815 geschaffenen Wiener Kongresssystems entschieden entgegentrat, aus Furcht, dies würde einen Schneeballeffekt in Richtung Revolution mit sich bringen. Eine präventive Phase zwischen Märzrevolution und Reichsgründung, die durch Wilhelms Konzepte und zielgerichtete Politik einer Konstitutionalisierung und Nationalisierung Preußens als deutschem Supremat gekennzeichnet ist – ein Integrationsangebot an die gemäßigten Kräfte der preußischen und deutschen Reformbewegung, das der Revolution den Wind aus den Segeln nehmen sollte. Und schließlich eine konservierende Phase nach 1871, in welcher der „Heldenkaiser“ seine nunmehr populäre Stellung dazu nutzte, das in den Kriegen 1866 und 1870/71 Gewonnene nach innen und außen abzusichern. Das deutsche Kaiserreich, seine Gründung und sein innerer Ausbau, können in diesem Kontext als Kulmination eines langjährigen antirevolutionären monarchischen Projekts Wilhelms I. betrachtet werden, dessen Grundzüge sich insbesondere auf die Revolutionserfahrungen 1848/49 zurückverfolgen lassen.
Prägend für die frühe politische Biographie des ursprünglich nicht für die Thronfolge vorgesehenen, da zweitgeborenen Prinzen waren insbesondere der Dekabristenaufstand im russischen Zarenreich 1825 und die Pariser Julirevolution 1830. Diese Ereignisse ließen in Wilhelm eine wahre Revolutionsparanoia wachsen – eine Paranoia, die er mit vielen monarchischen Akteuren des Vormärz teilte. Er plädierte stets dafür, vermeintliche revolutionäre Konfliktherde durch Zensur, Polizeimaßregeln und Waffengewalt im Keim zu ersticken. Mit dem Herrschaftsantritt seines älteren und kinderlosen Bruders Friedrich Wilhelm IV. 1840 gelangte Wilhelm als präsumtiver Thronfolger zu einer einflussreichen politischen Position. Diese nutzte er, um die Politik des in seinen Augen schwachen und wankelmütigen Königs zu torpedieren, insbesondere dessen ständische Reformpläne, die er als ersten Schritt in Richtung einer Konstitutionalisierung der Monarchie betrachtete. Die bisweilen antagonistische Beziehung der beiden königlichen Brüder trug während des Vormärz entschieden dazu bei, das öffentliche Ansehen der absolutistischen Hohenzollernmonarchie allgemein und speziell das Wilhelms als Thronfolger und Haupt der reaktionären Hofopposition zu desavouieren.
Der Ausbruch der Märzrevolution 1848 stellte schließlich eine elementare Zäsur dar. Als blutbefleckter „Kartätschenprinz“ verschrien, sah sich Wilhelm gezwungen, vor dem Zorn der Barrikadenkämpfer zeitweilig nach Großbritannien zu fliehen. Dort begann für ihn eine Phase der politischen Neuorientierung, die auch nach seiner Rückkehr auf die politische Bühne in Preußen nicht ihr Ende fand. Die Revolutionserfahrungen hatten Wilhelm die Schlussfolgerung ziehen lassen, dass die Monarchie zu ihrem Überleben der Unterstützung der Öffentlichkeit bedurfte und dass sie daher deren Forderungen teilweise entgegenkommen musste. Mit der Formel „Bajonette sind nur gut gegen die Bündnisse der Zeit aber nicht gegen die Wahrheit die in der Zeit liegt“, rechtfertigte er seine neue politische Flexibilität.[2] Insbesondere die beiden zentralen Forderungen der Revolution: die Konstitutionalisierung und Nationalisierung Preußens im Rahmen eines deutschen Einheitsstaates sollten als Integrationsangebot an die politisierte Bevölkerung übernommen und durchgesetzt werden, wollte die Krone ihr entscheidendes politisches Gewicht bewahren.
„Es gibt wohl keinen größeren Antagonisten der Constitution als mich, und wahrlich, die Neu-Zeit hat dies nicht vermindert“, schrieb er seiner Schwester, „aber kann man immer gegen den Strom schwimmen?
Dasselbe gilt auch von der sogenannten deutschen Träumerei.“[3]
Dem Parlament gestand er im neugeschaffenen konstitutionellen Rahmen zwar eine gesetzgebende Funktion zu, nicht jedoch eine Kontrolle der monarchischen Regierung. Das monarchische Herrschaftsprinzip, nicht der Parlamentarismus sollte das politische System prägen. Es war allerdings die bislang ungelöste Deutsche Frage, in der Wilhelm die entscheidende Möglichkeit sah, gleichzeitig ein zentrales Bedürfnis der revolutionären Massen zu befriedigen und den Thron innen- wie außenpolitisch zu stärken, sollte es gelingen, Berlin als Führungsmacht des zu schaffenden Nationalstaates zu etablieren. Die Nationalisierung der Hohenzollernmonarchie – die Verknüpfung nationaler und dynastischer Interessen – sollte die Krone im Inneren neu legitimieren und nach außen Preußen als deutschem Supremat eine einflussreichere Stellung im europäischen Mächtekonzert erlangen lassen. Seine Umgebung erschrak angesichts solcher augenscheinlich revolutionären Ideen. Wilhelm betonte daher deutlich, dass er ein antirevolutionäres monarchisches Projekt verfolgte:
„Das Nicht zu Standekommen einer Deutschen Einigung ist das Ziel der Révolution, die zwar diese Einigung auch an der Stirn trägt, aber nur um die Republik zu gründen, oder sonst Anarchie zu säen, bei der sich gut Fischen läßt. […] Ein einiges Deutschland ist keine Erfindung der Révolution, sondern ein tief liegendes Bedürfniß. […] man muß also die Sache aus den Händen der Révolution reißen, um sie correct zu formen. Auf diese Art eine Deutsche Einigkeit wollen heißt also nicht, die Gelüste der Révolution fördern, sondern ihnen entgegentreten.“[4]
Wie dies zu erreichen sei, ob auf friedliche oder kriegerische Weise, machte Wilhelm von den deutschen und europäischen Verhältnissen abhängig. „Wer Deutschland regieren will, muß es sich erobern; à la Gagern geht es nun einmal nicht“, schrieb er 1849 mit Blick auf den Präsidenten des Frankfurter Paulskirchenparlaments, Heinrich von Gagern.[5] Damit nahm er bereits Otto von Bismarcks 1862 ausgesprochenes Diktum vorweg, „nicht durch Reden oder Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden […] sondern durch Eisen und Blut.“[6]
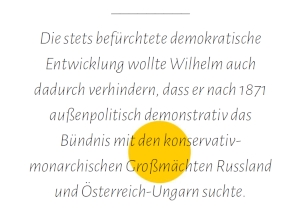
Anders als seine beiden Nachfolger auf dem Thron sollte Wilhelm jedoch nie Anhänger deutschnationalen Gedankenguts werden. Der Nationalismus war ihm stets nur Mittel zum Zweck des Machterhalts und -gewinns der Krone.
Die Chance, seine politischen Konzepte in die Tat umzusetzen, kam 1858, als er die Regentschaft für seinen unheilbar erkrankten Bruder übernahm; nach dem Tod Friedrich Wilhelms IV. 1861 sollte er als Wilhelm I. schließlich selbst den Thron besteigen. Mit dem von ihm selbst ausgewählten Ministerium der „Neuen Ära“ begann Wilhelm das Experiment eines persönlichen Regiments, das durch seine eigenhändige Leitung der Innen- und Außenpolitik gekennzeichnet war. In seinen ersten Herrschaftsjahren übte er seine Macht sehr aktiv aus: Wilhelm übernahm persönlich die Führung des Staatsministeriums, hatte er doch bewusst auf die Ernennung eines starken Ministerpräsidenten verzichtet. Er legte entscheidenden Wert darauf, dass seine Minister sich lediglich als Ausführungsorgane seines königlichen Willens betrachteten und in dieser Rolle gegenüber dem Parlament auftraten.
Da er Deutschlands „moralische Eroberung“ durch Preußen zum Ziel seiner Regierung erklärt hatte, hoffte er zunächst auf die Unterstützung des preußischen Landtags und der deutschen Öffentlichkeit. Diese Hoffnungen zerschlugen sich jedoch bald durch die verhärteten Fronten des innerpreußischen Verfassungskonflikts – eines Konflikts, den er auf die simple Formel „Krone gegen Parlament“ reduzierte.
„[…] in Preußen muß die Konstitution und deren Fortsetzung und Ausbau nie die Grenzen überschreiten, welche die Macht und Kraft des Königtums in einer Art schmälert, die dasselbe zum Sklaven des Parlaments macht“, verteidigte er seine rasch festgefahrene Position.[7] Denn seine Umgebung versuchte den König beständig in zwei entgegengesetzte Richtungen zu bewegen: Entweder Konzessionen gegenüber dem Landtag zu machen oder das konstitutionelle System per Staatsstreich abzuschaffen. Wilhelm entschied sich für eine dritte Option.
Im September 1862 ernannte er Bismarck zum Ministerpräsidenten – zum „Konfliktminister“. Anders als von Bismarck rückblickend porträtiert – und von vielen Historikern bis heute unkritisch übernommen – stellte Wilhelm diesem keine Blankovollmacht aus, sondern formulierte konkrete programmatische Bedingungen, wie in der inneren und deutschen Politik vorzugehen sei. Im Verfassungskonflikt musste Bismarck sich der kompromisslosen Position des Königs unterordnen und auch insgesamt besaß er im ersten Jahr seiner Regierung nur sehr eng gefasste Bewegungsmöglichkeiten. Dies änderte sich erst graduell nach dem erfolgreichen Krieg gegen Dänemark 1864. Doch auch Bismarcks weiteres Vorgehen bis 1871 wäre unmöglich gewesen, hätte der spätere „Eiserne Kanzler“ nicht die volle Unterstützung seines Monarchen genossen. Zwar kam es wiederholt zu Konflikten zwischen den beiden nicht immer harmonisierenden Persönlichkeiten, doch blieben diese stets den gemeinsamen politischen Zielen untergeordnet, die König und Ministerpräsident verfolgten: Die Verteidigung des monarchischen Prinzips gegen die Herausforderungen des Parlamentarismus und die Einigung Deutschlands unter preußischer Suprematie.
Mit der Reichsgründung erlebte Wilhelms Projekt des dynastischen Hijackings der Deutschen Frage seinen unbestrittenen Höhepunkt, auf den er seit 1848 zunächst weitestgehend allein, dann seit 1862 gemeinsam mit Bismarck hingearbeitet hatte. Doch auch im hohen Alter zur Zeit des Kaiserreichs begnügte er sich niemals mit der Rolle eines repräsentativen Monarchen und passiven Politikbeobachters „unter“ Bismarck, wie oft behauptet wurde und wird. Das Verhältnis von Kaiser und Kanzler kann trotz Bismarcks einzigartigem politischem Handlungsspielraum, den ihm Wilhelm infolge der Siege 1864, 1866 und 1870/71 gewährt hatte, als Weiterentwicklung des persönlichen Regiments der „Neuen Ära“ charakterisiert werden: Statt selbst zu versuchen, das Ministerium, den Regierungsalltag und die Auseinandersetzung mit Parlament und Öffentlichkeit zu leiten, überließ der Monarch diese Aufgaben zusehends Bismarck, von dem er wusste, dass jener in seinem Sinne handeln würde. Er griff nur dann ein, wenn er seinen Kanzler auf gefährlichen Abwegen für die Krone glaubte.
Diese Regierungs- und Arbeitsaufteilung sollte entschieden dazu beitragen, das monarchische Prinzip in Preußen und in Deutschland zu stärken, wo die Reichsverfassung die dominante Stellung des preußischen Königs und Deutschen Kaisers im gesamtdeutschen konstitutionellen System zementierte. Bereits bei den Verhandlungen im Staatsministerium im Dezember 1866 hatte Wilhelm entscheidenden Wert darauf gelegt, dass in der Verfassung des Norddeutschen Bundes – und der des späteren Kaiserreichs – die Macht der Krone nicht nur erhalten blieb, sondern auch ausgebaut wurde.
Der von vielen nunmehr als „Heldenkaiser“ gefeierte Monarch verteidigte auch nach 1871 seine Prärogative gegenüber den Parlamenten, insbesondere dem Reichstag als neugeschaffener Bühne gesamtdeutscher Politik. In seinen öffentlichen Auftritten ließ er keine Gelegenheit aus, den monarchischen Charakter des Kaiserreichs zu unterstreichen, während er hinter den Kulissen der Berliner Reichsleitung stets darauf drängte, dem Anspruch des Reichstags an Machtteilnahme mit aller Schärfe entgegenzutreten. Mit Argwohn und Verachtung verfolgte er die Parlamentsessionen und schimpfte, „daß der Reichstag sich in Alles mischen will, was ihn nichts angeht und nur sich und nicht das Land im Auge hat.“[8]
Die spätere Geringschätzung des Parlaments als „Quasselbude“ und „Reichsaffenhaus“ sollte der letzte Hohenzollernkaiser Wilhelm II. unisono von seinem Großvater übernehmen.
Dem monarchischen Prinzip stand auf parlamentarischer und gesellschaftlicher Ebene ein pluralistisches Politikmodell entgegen, dessen Entwicklung Kaiser und Kanzler im begrenzten Verfassungsrahmen durchaus erlaubten. Wilhelm machte jedoch auch deutlich, welche Gruppierungen im hohenzollernregierten Nationalstaat bewusst ausgeschlossen wurden. So brauchte es nicht erst Bismarcks Einflüsterungen, um den Kaiser früh von einer kompromisslosen Haltung im Kulturkampf gegen den politischen Katholizismus zu überzeugen. Während der Repressionspolitik gegen die Sozialdemokratie war es sogar der Kanzler, der von seinem Souverän immer wieder zu einer härteren Linie gegen die „Umsturzpartei“ gedrängt wurde. Auch öffentlich brandmarkte Wilhelm mit seiner monarchischen Autorität und Popularität die vermeintlichen „inneren Reichsfeinde“ und half so die innenpolitischen Spannungslinien zu verschärfen, welche Deutschland bis zum Untergang des Kaiserreichs 1918 – und darüber hinaus – entscheidend prägen sollten.
Betreffs nationaler und religiöser Minderheiten in Deutschland nahm Wilhelm persönlich zwar eine moderierende Haltung ein, da ihn als Kind des Ancien Régime ideologisch wenig mit der Generation des pseudo-biologisch rassischen Nationalismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts verband. Doch ließ er sowohl antisemitische Agitatoren als auch Bismarck und dessen Germanisierungspolitik gegen Polen und Dänen gewähren, da er hierin keine Gefahr für die Monarchie erblickte.
Die stets befürchtete demokratische Entwicklung wollte Wilhelm auch dadurch verhindern, dass er nach 1871 außenpolitisch demonstrativ das Bündnis mit den konservativ-monarchischen Großmächten Russland und Österreich-Ungarn suchte sowie die friedensichernde Ausgleichspolitik Bismarcks unterstützte und gegen dessen präventivkriegsfavorisierende Kritiker verteidigte. Die politische und militärische Allianz der drei Kaiserreiche begriff er als antirevolutionäres Bollwerk – sowohl gegen gesamteuropäisch agierende demokratische, sozialistische und anarchistische „Umsturzparteien“ als auch gegen die westlichen Großmächte: das republikanische Frankreich und das parlamentarisch regierte Großbritannien, in den Augen des Kaisers ein Königreich „in name only“.
Als Wilhelm im März 1888 mit fast 91 Jahren verstarb, befand sich die Hohenzollernmonarchie auf dem Höhepunkt ihrer Popularität, politischen Legitimität und Stabilität: Die etwa 200.000 Trauergäste, die dem Beerdigungszug des „Heldenkaisers“ durch Berlin beiwohnten, sowie unzählige Trauerbekundungen im ganzen Kaiserreich und von Deutschen aus Übersee waren für alle Welt sichtbare Beweise für den Erfolg des monarchischen Projekts des ehemaligen „Kartätschenprinzen“. Kronprinzessin Victoria, eine scharfe Kritikerin der Politik ihres kaiserlichen Schwiegervaters und seines Kanzlers, hatte bereits 1885 über das Kaiserreich treffend bemerkt:
„Der Kaiser u[nd] der Fürst Bismarck sind die Schöpfer dieser Dinge gewesen u[nd] der Stempel ihrer Persönlichkeit u[nd] ihrer Auffassungen sind allen Dingen aufgedrückt. Es kann nie wieder einen Kanzler geben wie den Fürsten Bismarck; – kein anderer Kaiser hätte so zu ihm gepaßt, u[nd] unter diesen Männern allein ist entstanden, was wir heute vor uns sehen, – ein eigenartiges Gebilde mit seinen großen Seiten, aber auch mit seinen Schwächen.“[9]
Wilhelm hatte es bis zuletzt als seine und seiner Dynastie Aufgabe betrachtet, das monarchische Prinzip zu verteidigen. Indem er die Verpflichtung zum Kampf gegen Parlamentarismus und Demokratie auch an seinen Enkel Wilhelm II. bewusst weitergab und diesen als seinen persönlichen politischen Erben betrachtete und behandelte, prägte das Herrschaftsverständnis Wilhelms I. die weitere Entwicklung des Kaiserreichs auch über seinen Tod in hohen Maßen hinaus.
[1] Wilhelm an seine Schwester Charlotte, Zarin Alexandra Fjodorowna, 13. November 1831, in: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), Brandenburg-Preußisches Hausarchiv (BPH), Rep. 51, Nr. 857.
[2] Wilhelm an Leopold von Orlich, 22. Mai 1850, in: Hermann von Egloffstein (Hrsg.), Kaiser Wilhelm I. und Leopold von Orlich, Berlin 1904, S. 38.
[3] Wilhelm an Charlotte, 11. März 1850, in: GStA PK, BPH, Rep. 51 J, Nr. 511a, Bd. 2, Bl. 487.
[4] Wilhelm an Charlotte, 12. September 1849, in: GStA PK, BPH, Rep. 51 J, Nr. 511a, Bd. 2, Bl. 462.
[5] Wilhelm an Oldwig von Natzmer, 20. Mai 1849, in: Gneomar Ernst von Natzmer (Hrsg.), Unter den Hohenzollern. Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Generals Oldwig v. Natzmer, Bd. 4, Gotha 1889, S. 64.
[6] Rede Otto von Bismarcks in der Budgetkommission des Abgeordnetenhauses, 29. September 1862, in: Wilhelm Schüßler (Hrsg.), Bismarck. Die gesammelten Werke, Bd. 10, Berlin 1928, S. 140.
[7] Wilhelm I. an Großherzog Friedrich I. von Baden, 17. Februar 1862, in: Hermann Oncken (Hrsg.), Großherzog Friedrich I. von Baden und die deutsche Politik von 1854-1871. Briefwechsel, Denkschriften, Tagebücher, Bd. 1, Berlin/Leipzig 1927, S. 322.
[8] Wilhelm I. an seine Ehefrau Augusta, 27. Mai 1871, in: GStA PK, BPH, Rep. 51 J, Nr. 509b, Bd. 16, Bl. 69.
[9] Kronprinzessin Victoria an Heinrich Friedberg, 1. Juli 1885, in: Winfried Baumgart (Hrsg.), Bismarck und der deutsche Kolonialerwerb 1883–1885. Eine Quellensammlung, Berlin 2011, S. 480.
