Die Tripolarität der Reichshauptstadt: Berliner Politik im Spannungsfeld von Reich, Staat und Kommune 1871-1918
Lennart Bohnenkamp
Die Tripolarität der Reichshauptstadt
Es war schon ein seltsames Gebilde, das vor fast 150 Jahren im Spiegelsaal von Versailles das Licht der Welt erblickte. Das deutsche Kaiserreich war ein Kuriosum, ein Unikum in der Verfassungsgeschichte des 19. Jahrhunderts. Das Reich war nämlich kein Einheitsstaat wie die 1870 gegründete Dritte Französische Republik oder das 1861 gegründete Königreich Italien, auch kein Bundesstaat wie das 1830 gegründete Königreich Belgien oder die 1865 neu gegründeten Vereinigten Staaten von Amerika. Die Eigenartigkeit des Kaiserreichs bestand in seinem „hegemonialen Föderalismus“ (Thomas Nipperdey), in dem diffusen Miteinander, Nebeneinander und Gegeneinander von preußischen Institutionen und Reichsinstitutionen in der doppelten Hauptstadt Berlin.
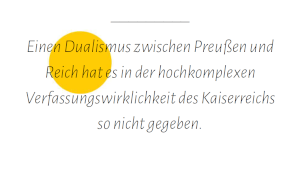
In der geschichtswissenschaftlichen Forschung gehen die Meinungen, wie die historische Bedeutung dieses seltsamen Gebildes einzuschätzen ist, weit auseinander: Die eine Seite sieht in der preußischen Hegemonie den Kern eines Sonderweges, der Deutschland in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts hineingeführt habe: in den Ersten und Zweiten Weltkrieg, in das NS-Regime und seine Verbrechen, in den Kalten Krieg und die deutsch-deutsche Teilung. So etwa argumentiert aktuell Eckart Conze in seinem Werk: „Schatten des Kaiserreichs. Die Reichsgründung von 1871 und ihr schwieriges Erbe“ (2020). Die andere Seite sieht in der preußischen Hegemonie eher ein Relikt aus alten Zeiten, eine überholte Tradition, die sich im Kaiserreich bis in die Vorkriegszeit hinein immer weiter abgeschwächt habe. Im Mittelpunkt dieser sogenannten Parlamentarisierungs- und Unitarisierungsthese stehen daher nicht die preußischen Institutionen, sondern die Reichsinstitutionen und vor allem der Reichstag mit seinem wachsenden Einfluss auf die Reichsregierung. Einer der wirkmächtigsten Befürworter dieser These war in den letzten Jahren Christopher Clark in seinem Werk über „Preußen. Aufstieg und Niedergang 1600-1947“ (2007).
Beides ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Denn beide Ansätze konstruieren einen Dualismus zwischen Preußen und Reich, den es in der hochkomplexen Verfassungswirklichkeit des Kaiserreichs so nicht gegeben hat. Aus einer integrativen, kulturgeschichtlich inspirierten Perspektive heraus frage ich daher insbesondere nach den Wechselwirkungen und Verflechtungen zwischen preußischer Politik und Reichspolitik in der doppelten Hauptstadt Berlin. Die Berliner Politiker bewegten sich, so meine Grundannahme, in einem Spannungsfeld, dessen drei Pole das Reich, der Staat Preußen und nicht zuletzt auch die Stadtgemeinde Berlin bildeten. Jeder dieser Pole bildete in der politischen Topografie Berlins ein eigenes Machtzentrum heraus: das kommunale Machtzentrum mit dem Roten Rathaus im historischen Stadtkern von Alt-Berlin, das preußische Machtzentrum mit seinem Parlaments- und Regierungsviertel im Westen der Friedrichstadt und schließlich das Machtzentrum des Reichs, das zunächst in das preußische Viertel hineingebaut wurde, später aber mit dem Reichstagsneubau am Rande des Tiergartens einen eigenen Schwerpunkt herausbildete.
Es war gerade diese Tripolarität der Reichshauptstadt, so meine Hauptthese, die für den „hegemonialen Föderalismus“ des Kaiserreichs charakteristisch war. Denn das Besondere am Regierungssystem des Kaiserreichs war, dass viele Politiker in Personalunion Doppel- oder sogar Dreifachfunktionen ausübten, die sie auf allen drei Spielfeldern der Berliner Politik zu gefragten Mitspielern machten.
Das System der Personalunionen in der Verfassungswirklichkeit des Kaiserreichs
Von diesen Personalunionen war nur die Personalunion des Monarchen in der Reichsverfassung festgeschrieben. Aus der Personalunion des Monarchen, der als König von Preußen auch Kaiser des Reiches war, leiteten sich alle weiteren Personalunionen auf der Regierungs- und Parlamentsebene ab.
Auf der Regierungsebene war der Reichskanzler immer zugleich auch Vorsitzender des Bundesrats, fast durchgängig preußischer Außenminister und meist auch zugleich preußischer Ministerpräsident. Die Staatssekretäre der Reichsämter waren zugleich preußische Bevollmächtigte im Bundesrat und konnten zusätzlich zu preußischen Ministern ohne Ressort ernannt werden. Die preußischen Ressort-Minister wiederum vertraten als preußische Bundesratsbevollmächtigte die Regierung im Reichstag. Der Berliner Oberbürgermeister schließlich hatte nach der preußischen Verfassung einen ständigen Sitz im Herrenhaus. Und die Stadträte im Berliner Magistrat übten häufig nebenbei ein Mandat im Reichstag oder im Abgeordnetenhaus aus.
Auch auf der Parlamentsebene gab es zahlreiche Doppelmandate in allen erdenklichen Kombinationen: Das klassische Doppelmandat war die gleichzeitige Mitgliedschaft im Reichstag und im Abgeordnetenhaus, aber es gab auch Parlamentarier, die Mitglied im Reichstag und gleichzeitig im Herrenhaus waren. Im Reichstag saßen so viele Mitglieder des preußischen Landtags, dass Zeitgenossen wie August Bebel um die Jahrhundertwende den Eindruck haben konnten, sie hätten nicht den deutschen Reichstag, sondern immer noch den „Norddeutschen Reichstag“ vor sich. Und auch viele Berliner Stadtverordnete hatten zusätzliche Mandate im Reichstag oder Abgeordnetenhaus, einige Parlamentarier hatten sogar Dreifachmandate und vertraten ihre Partei in allen drei Berliner Parlamenten.
Wechselwirkungen im Spannungsfeld von Reich, Staat und Kommune
Aus diesen personellen Verflechtungen entwickelten sich starke Wechselwirkungen zwischen Reich, Staat und Kommune, die das politische System in den ersten Jahren nach der Reichsgründung zunächst stabilisierten. Im besten Fall konnten diejenigen Akteure, die sich in der Tripolarität der Reichshauptstadt zurechtfanden, ihren Einfluss in Gesetzgebungsprozessen auf allen drei Ebenen geltend machen und dabei Interessengegensätze zwischen Reich, Staat und Kommune moderieren und ausgleichen.

Doch das Momentum von 1871 brachte dem Kaiserreich kein Glück. Was der Kaiser und seine Minister und die Parlamentarier in den Spiegeln von Versailles nicht sehen konnten, war die in den 1880er Jahren beginnende „Hochmoderne“ (Ulrich Herbert) mit all ihren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und auch politischen Umwälzungen, für die das Reich im Jahr 1871 weder gedacht noch gemacht worden war. Unter diesen neuartigen Bedingungen des politischen Handelns erwies sich der „hegemoniale Föderalismus“ schon bald als Fehlkonstruktion. Die Wechselwirkungen zwischen Reich, Staat und Kommune erzeugten seit den 1880er Jahren drei hochkomplexe Problemfelder, die sich im Laufe der Jahrzehnte wechselseitig verstärkten und schließlich in der Vorkriegszeit zu einem geradezu unlösbaren Problemkomplex verdichteten. Diese drei Problemfelder sind von der Forschung zwar bereits punktuell untersucht worden, jedoch meist nur für die Reichspolitik und nicht im Spannungsfeld von Reich, Staat und Kommune in der doppelten Hauptstadt Berlin:
1. Problemfeld: Die Entstehung des Interventions- und Sozialstaats und die damit einhergehende Professionalisierung des Politikbetriebs ließ die Arbeitsbelastung der Berliner Politiker seit den 1880er Jahren drastisch ansteigen. Die Gesetzgebung wurde umfassender und komplexer, die Berliner Parlamente mussten nun häufiger und länger tagen. Für Doppelmandatare war das ein Problem: Überschneidungen von Sitzungsterminen ließen sich nicht mehr vermeiden, ohne „Schwänzen“ war da nichts zu machen, die Parlamente waren aufgrund der vielen abwesenden Parlamentarier häufiger beschlussunfähig. Der Regierung ging das nicht anders: Kein Regierungschef – auch der chronisch überarbeitete Bismarck nicht – war auf Dauer dazu in der Lage, die Geschäfte eines Reichskanzlers, preußischen Außenministers und preußischen Ministerpräsidenten mit voller Verantwortung zu führen. Eine funktionale Differenzierung der Doppel- und Dreifachfunktionen innerhalb der Regierung und innerhalb der Parlamente war die unvermeidbare Folge. Mit der Einführung von Reichstagsdiäten im Jahr 1906 kam es schließlich in allen Parteien zu einem drastischen Rückgang der Doppelmandate und somit zu einer weiteren Entflechtung derjenigen Instanzen, deren Aufgabe ursprünglich die Synchronisierung der Berliner Politik gewesen war.
2. Problemfeld: Die unterschiedlichen Wahlrechtssysteme führten seit den 1890er Jahren zu einem immer schärferen Auseinanderdriften der parteipolitischen Mehrheitsverhältnisse in den drei Berliner Parlamenten. In den 1870er Jahren waren alle drei Parlamente noch von den Liberalen dominiert worden. Das änderte sich jedoch schon bald. Denn die unterschiedlichen Wahlrechtssysteme in Reich, Staat und Kommune reflektierten die gesellschaftlichen Umwälzungen auch unterschiedlich stark. Im Reichstag, der nach dem gleichen Wahlrecht gewählt wurde, stellte die katholische Zentrumspartei seit den 1890er Jahren immer die stärkste Fraktion. Nur bei der Wahl von 1912 konnten die Sozialdemokraten knapp am Zentrum vorbeiziehen. Im preußischen Abgeordnetenhaus, das nach dem Dreiklassenwahlrecht gewählt wurde, drifteten die Mehrheitsverhältnisse dagegen deutlich nach rechts: Hier stellten die Konservativen seit den 1880er Jahren immer die stärkste Fraktion. In der Berliner Stadtverordnetenversammlung, die ebenfalls nach dem Dreiklassenwahlrecht gewählt wurde, drifteten die Mehrheitsverhältnisse dagegen deutlich nach links: Die Liberalen blieben zwar vom Anfang bis zum Ende des Kaiserreichs die stärkste Fraktion, aber ihr Vorsprung auf die Sozialdemokraten schmolz dahin. Die unterschiedlichen Mehrheitsverhältnisse in den Berliner Parlamenten erschwerten den Regierungen, die an der Spitze noch immer in Personalunion geführt wurden, die Konzeption einheitlicher Regierungsrichtlinien, die Bildung stabiler Parteikoalitionen und das Aushandeln parlamentsübergreifender Kompromisse. Und für eine Reform der unterschiedlichen Wahlrechtssysteme, welche die auseinanderdriftenden Parlamentsmehrheiten einander wieder angenähert hätte, gab es weder im Reichstag noch im Landtag eine Mehrheit.
3. Problemfeld: Die dreifache „Parlamentarisierung“ im Reich, in Preußen und in der Stadtgemeinde Berlin engte die Handlungsspielräume der Regierungen zusätzlich ein: In der Berliner Kommunalpolitik war das parlamentarische Regierungssystem am weitesten vorangeschritten. Der Oberbürgermeister wurde nicht wie der Reichskanzler oder der preußische Ministerpräsident vom Monarchen ernannt, sondern vom Kommunalparlament gewählt und dann nur noch vom Monarchen bestätigt – eine Formsache. Im preußischen Abgeordnetenhaus ging der Einfluss der Konservativen zwar nicht so weit, dass sie die Staatsregierung selbst bilden oder stürzen konnten. Aber der Staatssekretär und Staatsminister Clemens von Delbrück, der in seinem Regierungsamt sowohl mit dem Reichstag als auch mit dem Landtag zusammenarbeitete, erinnerte sich in seinen Memoiren an die starke Stellung der Konservativen im preußischen Landtag:
„Die Macht des Parlaments war daher in Preußen außerordentlich groß. Man konnte dort wohl der Sache nach von einem parlamentarischen Regime sprechen, da die Regierung in starker Abhängigkeit von der im Landtag dominierenden konservativen Partei die Geschäfte nach deren Wünschen führte.“
Die Parlamentarisierungstendenzen im Reichstag wiederum sind im Gegensatz zu den gleichartigen Tendenzen in Preußen von der Forschung bereits gut dokumentiert. Gleichzeitig waren jedoch gerade im Reich und in Preußen die Personalunionen auf Regierungsebene ein Hindernis für den Durchbruch zur parlamentarischen Monarchie. Wie sollte ein Reichskanzler und Ministerpräsident parlamentarisch regieren, wenn er sich zwar auf eine Mehrheit in einem der beiden Berliner Parlamente stützen konnte, aber nicht gleichzeitig das Vertrauen der Mehrheit in dem jeweils anderen Berliner Parlament besaß?
Diese Situation trat im Juni 1913 ein: Die große Mehrheit des Reichstags hatte den Reichskanzler dazu gedrängt, zur Finanzierung der neuen Wehrvorlage auch eine direkte Reichssteuer einzuführen. Nur die Konservativen hatten sich im Reichstag dagegen ausgesprochen. Die Forschung, die sich in dieser Frage meist nur auf die Reichspolitik konzentriert und dabei die Rückwirkungen auf Preußen übersieht, greift zu kurz, wenn sie hier lediglich von einer Isolierung der preußischen Konservativen im Reichstag spricht. Als Bethmann Hollweg nämlich am 30. Juni 1913 in seiner Rolle als Reichskanzler dem Kompromiss mit dem Reichstag notgedrungen zustimmte, löste diese Entscheidung eine schwere Regierungskrise aus. Denn nur einen Tag später kündigte der Fraktionsvorsitzende der Konservativen im Abgeordnetenhaus an, dass er Bethmann in dessen Rolle als Ministerpräsident im Abgeordnetenhaus für diesen Kompromiss zur Rechenschaft ziehen werde. Der Preis für Bethmanns Erfolg als Reichskanzler war also sein Misserfolg als Ministerpräsident. Resigniert stellte er im Juli 1913 fest, „daß gegen die Konservativen in Preußen Deutschland nicht regiert werden könne“. Umgekehrt galt Bethmanns Erkenntnis freilich auch: Das Reich konnte nicht nur gegen die Konservativen, sondern auch mit den Konservativen nicht mehr regiert werden. Im Winter 1913/14 eskalierte diese ohnehin schon zerfahrene Situation in der sogenannten Zabern-Affäre. Als der Reichskanzler und Ministerpräsident Bethmann wegen seines Verhaltens während der Zabern-Affäre im Reichstag und Landtag ein doppeltes Misstrauensvotum erhielt – und das aus jeweils entgegengesetzten Motivlagen – stand das Kaiserreich am Rande der Unregierbarkeit: Dem nach links driftenden Reichstag war der Ministerpräsident Bethmann zu rechts. Und dem nach rechts driftenden Landtag war der Reichskanzler Bethmann zu links. Der Reichskanzler und Ministerpräsident wurde von den immer selbstbewusster auftretenden Berliner Parlamenten und ihren auseinanderdriftenden Mehrheiten geradezu in der Luft zerrissen.
Eine durchschlagende Parlamentarisierung wäre daher nur bei einer konsequenten Ämtertrennung auf Regierungsebene möglich gewesen. Diese Option stand jedoch aufgrund der alles überragenden Personalunion des Monarchen nicht zur Verfügung: Das monarchische Prinzip erlaubte es nicht, dass ein liberaler oder gar katholischer Reichskanzler, der das Vertrauen seines persönlich regierenden Kaisers besaß, gegen einen konservativen Ministerpräsidenten regierte, der das Vertrauen seines persönlich regierenden Königs von Preußens besaß. Die unteilbare Person des Monarchen konnte sich nicht selbst bekämpfen.
Die Dysfunktionalität des
Regierungssystems vor 1914
Aus der wechselseitigen Verstärkung aller drei Problemfelder resultiert meine Hauptthese: Die Professionalisierung des Politikbetriebs, das Auseinanderdriften der Mehrheitsverhältnisse und die dreifache „Parlamentarisierung“ führten zu einer zunehmenden Desintegration bis hin zur Dysfunktionalität des preußisch-deutschen Regierungssystems vor 1914: Auf allen politischen Ebenen waren in der Vorkriegszeit Entflechtungs- und Auflösungserscheinungen zu beobachten: Der Reichskanzler und die Staatssekretäre der Reichsämter zogen sich immer weiter aus der Mitarbeit im preußischen Staatsministerium und im preußischen Landtag zurück; die preußischen Minister wiederum zogen sich immer weiter aus der Mitarbeit im Reichstag und im Bundesrat zurück. Die Parlamentarier wiederum spezialisierten sich zunehmend entweder auf den Reichstag oder auf den Landtag oder auf die Stadtverordnetenversammlung. Die Regierungsmaschine stand in der Vorkriegszeit nahezu still: Die Wehrvorlage war nach 1911 die letzte große Reform vor dem Kriegsausbruch. Es war wiederum Clemens von Delbrück, der die vielfältigen Funktionsstörungen des „hegemonialen Föderalismus“ schon im Jahr 1912 in einer Denkschrift auf den Punkt brachte:
„Es ist natürlich, daß unter diesen Umständen in den Beziehungen der Reichsressorts und der Preußens das Gegensätzliche anfängt, stärker zu wirken als die politische Überzeugung von der Notwendigkeit eines organischen Zusammenhanges zwischen der Leitung des Reichs und des führenden Bundesstaats.“
Eine Lösung für diesen Problemkomplex wusste Delbrück in seiner Denkschrift allerdings auch nicht. Der Kriegsausbruch im August 1914 bereitete solchen Überlegungen ein jähes Ende.
Versuch einer Synthese
Aus diesem Befund lässt sich entgegen der bisherigen Forschungskontroverse weder ein preußisch-deutscher Sonderweg noch eine Parlamentarisierung oder Unitarisierung des Kaiserreichs ableiten. Meine Neuinterpretation besteht vielmehr darin, der Eigenartigkeit des Kaiserreichs mit einer Synthese aus beiden Ansätzen zu begegnen: Nicht die vermeintliche Blockade einer politischen Modernisierung war das Dilemma des deutschen Kaiserreichs, sondern die Unfähigkeit seines Regierungssystems, die durchaus vorhandenen Modernisierungstendenzen im Rahmen seiner hyperkomplexen Verfassungswirklichkeit so zu kanalisieren, dass sie sich nicht destruktiv, sondern produktiv auswirkten.
Literatur:
Goldschmidt, Hans, Das Reich und Preußen im Kampf um die Führung. Von Bismarck bis 1918. Berlin 1931
Haardt, Oliver F. R., Innenansichten des Bundesrates im Deutschen Kaiserreich 1871–1918. In: Historische Zeitschrift 310 (2020), 333–386
Hähnel, Paul Lukas, Mehrebenen-Parlamentarismus im Deutschen Kaiserreich. Eine quantitative und qualitative Bestandsaufnahme parlamentarischer Doppelmandate. In: Archiv für Sozialgeschichte 58 (2018), 125–144
von Westarp, Kuno, Konservative Politik im letzten Jahrzehnt des Kaiserreiches. Band 1: Von 1908 bis 1914. Berlin 1935
