Marine, Ministerverantwortlichkeit und Parlament im frühen Kaiserreich
Sebastian Rojek
Am 31. Mai 1878 wurde die junge Kaiserliche Marine von einem schweren Unglücksfall getroffen: Am Vormittag dieses Tages kollidierte das Panzerschiff Großer Kurfürst bei seiner allerersten Ausfahrt mit seinem Schwesterschiff König Wilhelm vor der britischen Küste auf dem Weg zu einer Geschwaderübung. Die Marine musste den Totalverlust eines ihrer modernsten Kriegsschiffe und überdies den Tod von 269 Seeleuten verkraften. Da die Medien das Unglück sogleich als eine Katastrophe deuteten, welche die gesamte Nation getroffen habe, kam es zu einer annähernd zweijährigen öffentlichen Debatte um die Ursachen des Unglücks. Im Mittelpunkt stand der Staatssekretär der Marine, General-Admiral Albrecht von Stosch, dessen Amtsführung bald als Ursache des Unfalls galt. Die komplexe Debatte erreichte schließlich im März 1880 verfassungspolitische Dimensionen, als die Linksliberalen im Reichstag „eine Art Misstrauensvotum“ gegen den Chef der Marine einbrachten, um ihn dazu zu zwingen, der Öffentlichkeit endlich volle Rechenschaft über die Ursachen des Unglücks zu geben. Obwohl der Antrag an den Mehrheitsverhältnissen im Parlament scheiterte, kann der in der Forschung bisher kaum beachtete Fall doch als Sonde dienen, um etwas über die Demo kratisierungs- bzw. Parlamentarisierungspotentiale im frühen Kaiserreich zu erfahren. Um zu verstehen, warum das Unglück überhaupt bis in die Höhen liberaler Verfassungspolitik führte, gilt es zunächst die Lage der Seestreitkräfte nach den sogenannten Einigungskriegen zu skizzieren.
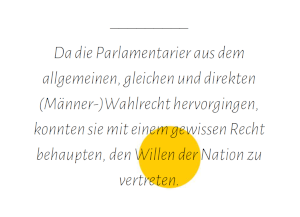
In den Preußisch-Deutschen Kriegen von 1864, 1866 und 1870/71 war die kleine Marine des Norddeutschen Bundes militärisch bedeutungslos gewesen. Aus Sicht der politischen und landmilitärischen Führungsspitzen sowie weiter Teile der Öffentlichkeit und des Parlaments waren die Seestreitkräfte nicht an dem gemeinsamen Waffengang beteiligt gewesen, der die geeinte Nation erst schuf. Deshalb sollte ein Armeegeneral an ihre Spitze gestellt werden, um dieser Institution die angeblich notwendige Disziplin einzuimpfen und einen erfolgreichen Flottenaufbau zu gewährleisten. Die Wahl fiel auf den General von Stosch, der während des Deutsch-Französischen Krieges durch sein Organisationstalent aufgefallen war. Stosch stand auf seiner neuen Position vielfältigen Herausforderungen gegenüber: Die Konservativen sahen die Marine kritisch, „weil sie 1848 entstand und deshalb für ein Kind gefährlicher Freiheit galt“, wie sich der Konter-Admiral Richard Dittmer später erinnerte. Auch innerhalb seines Ressorts stieß Stosch auf Widerstand, da erfahrene Admirale, die gehofft hatten, selbst an die Spitze rücken zu können, dem General weichen mussten. Hinzu kam, dass Stosch sich erst einmal Ansehen innerhalb seiner Behörde erarbeiten musste, da er bei den Seeoffizieren als „Landratte“ galt und ihn sein harscher Ton im persönlichen Umgang zunächst wenig beliebt machte. Stoschs neues Amt als Staatssekretär der Marine, beziehungsweise Marineminister, wie es zeitgenössisch häufig vereinfachend hieß, setzte voraus, dass er sich mit dem Reichstag auseinandersetzte. Denn seine Position bewegte sich zwischen verschiedenen konstitutionellen Sphären. Aufgrund der kaiserlichen Kommandogewalt unterstand er in militärischen Fragen direkt dem Monarchen. In Verwaltungsfragen war er als Staatssekretär dem Reichskanzler untergeordnet. Darüber hinaus war er in Fragen des Budgets vom Reichstag abhängig. Die Stellung Stoschs verkomplizierte sich noch dadurch, dass er als Liberaler galt, der dem Kronprinzen nahestand und unter einem Kaiser Friedrich III. zum Kanzler avancieren könnte. Reichskanzler Bismarck nahm den General-Admiral deshalb als Konkurrenten wahr; während seiner Amtszeit kam es immer wieder zu Konflikten zwischen den beiden Männern, in die Kaiser Wilhelm I. regelmäßig schlichtend eingreifen musste.
Stoschs Ausgangslage war also alles andere als einfach und er fühlte sich angesichts der zahlreichen neuen Herausforderungen zu Beginn „wie ein Schuljunge“. Seine wichtigste Aufgabe bestand zunächst darin, eine Parlamentsmehrheit davon zu überzeugen, in einen Flottenbau zu investieren, der das neue Reich zu einer veritablen Seemacht machen sollte. Obwohl dem Reichstag aufgrund der kaiserlichen Kommandohoheit kein direkter Zugriff auf das Militär zustand, so bot doch das Budgetrecht den Parlamentariern einen Hebel, um die Entwicklung der militärischen Institutionen kontrollieren zu können. Es ist zwar richtig, dass das Parlament im Kaiserreich keinen Einfluss auf die Regierungsbildung hatte und auch keine Ministerverantwortlichkeit vorlag, aber die Forschung der letzten Jahre hat doch deutlich werden lassen, dass der Reichstag die prägende Institution nationaler Politik gewesen ist. Dies hing vor allem damit zusammen, dass das Parlament im Laufe der 1870er-Jahre zu einer „Bühne“ nationaler Politik avancierte, die im Zentrum der politischen Presseberichterstattung stand und Staatssekretären und Abgeordneten den Weg zu reichsweiter Bekanntheit eröffnete. Da die Parlamentarier aus dem allgemeinen, gleichen und direkten (Männer-)Wahlrecht hervorgingen, konnten sie mit einem gewissen Recht behaupten, den Willen der Nation zu vertreten. Das fortschrittlichste Wahlrecht Europas bildete für das Parlament sowohl eine Argumentationsressource, um Ansprüche zu stellen, als auch einen Grund dafür, warum die (liberale) Presse den Reichstag immer wieder als Stimme der Nation beschrieb.
Stosch stand also einer rasch an Selbstbewusstsein gewinnenden Institution gegenüber, als er sich auf seinen ersten Auftritt auf dieser Bühne vorbereitete. Stoschs Freund, der liberale Schriftsteller Gustav Freytag, hatte diese zentrale Stellung des neuen Parlaments schon früh antizipiert und bot sich dem General daher als informeller Medienberater an, um ihm dabei zu helfen, die Auftritte im parlamentarischen Kommunikationsraum erfolgreich zu gestalten. Noch vor Stoschs Jungfernrede im Reichstag riet Freytag seinem Freund, sich mit den Abgeordneten gut zu stellen, auf militärischen Befehlston zu verzichten und eine offenherzige Kommunikationsstrategie zu wählen: „Die Leitung der M[arine] muß freundlich und […] mitteilend gegenüber der Nation sein. Die Leute wollen für das Geld, das sie diesem großen Interesse zahlen auch hübsch reichlich und regelmäßig von demselben erfahren.“
Nur „ehrliche Offenheit und würdevolle Freundlichkeit“, könnte die gegenüber dem Militär vorhandenen Vorurteile der „klugen Leute vom Reichstag“ abbauen helfen und „durch die Reichstagsritzen“ Stoschs „Renomee über das Land“ verbreiten. Tatsächlich folgte Stosch diesem Rat und verblüffte die Abgeordneten bei seiner Jungfernrede mit dem Eingeständnis, er habe keine Kompetenzen auf dem Gebiet der Marine, müsse sich erst einarbeiten und bitte daher das Parlament um einen Vertrauensvorschuss. Erst in einigen Jahren könne er einen Flottenplan vorlegen, über den dann aber die Abgeordneten souverän entscheiden dürften. Dass ein General dem Reichstag scheinbar so weitreichende Kompetenzen über sein Ressort zubilligte, beeindruckte die Parlamentarier. In der Folge entwickelte sich ein kooperatives Verhältnis zwischen dem General-Admiral und insbesondere den liberalen Fraktionen. Im liberalen Ideenhaushalt galt nämlich eine starke Flotte spätestens seit der Revolution von 1848 als Symbol einer geeinten und souveränen Nation. Stoschs liberales Image und seine offene Art gegenüber dem Reichstag, die sich auch in Einladungen an die Abgeordneten, die Flotte zu besuchen, ausdrückte, führte dazu, dass der Flottenaufbauplan von 1873 angenommen wurde. Stosch ging geschickt auf die liberalen Vorstellungen ein und inszenierte die Flotte, etwa anlässlich des Stapellaufs der Großen Kurfürst, als symbolische Repräsentation der Nation, die sich nach der errungenen Reichseinigung nun anschickte, auch die Weltmeere zu erobern.
Die Marinepolitik fügte sich in dieser Phase also nahtlos in den Kontext der liberalen Ära im ersten Jahrzehnt nach der Reichsgründung ein, als die Nationalliberalen die Partner der Regierung bei der Ausgestaltung zentraler nationaler Politikfelder waren, ohne jedoch die Verfassungsordnung anzutasten und etwa nach einer Parlamentarisierung zu streben. Warum auch? Sie glaubten, der Zeitgeist sei auf ihrer Seite, während Bismarck gemeinsam mit ihnen eine liberale Agenda betrieb, früher oder später – so der Fortschrittsglaube – müsse dann auch die Parlamentarisierung folgen. Gegen Ende der 1870er-Jahre allerdings geriet diese Kooperationspolitik in eine Krise: Die Liberalen verloren in der Wählergunst, waren durch innere Spaltungen geschwächt, und eine ökonomische Krise nährte Zweifel an einer liberal ausgestalteten Wirtschaftspolitik. Genau in diese Phase fiel die Schiffskatastrophe. Hier ist nicht der Raum, die verästelte Debatte um das Unglück in allen Facetten darzustellen, weshalb im Folgenden allein die politische Dimension beleuchtet wird.
Infolge des Unglücks fokussierte sich die öffentliche Diskussion immer stärker auf die Person Stoschs, dem nun die Kompetenz abgesprochen wurde, die Marine adäquat leiten zu können. Sein landmilitärisch geprägtes System sei der Komplexität dieser Institution nicht angemessen und führe sie dem Ruin entgegen, wie das Unglück beweise. Stosch leitete daraufhin eine Abkehr von seiner bisherigen Kommunikationspolitik ein, verschanzte sich hinter der kaiserlichen Kommandohoheit und wollte über die Ursachen des Unglücks keine öffentliche Stellungnahme abgeben. Deshalb forderte die Presse von der „Vertretung des deutschen Volkes“, sich der Sache anzunehmen. In den folgenden zwei Jahren konfrontierten die Parlamentarier den Staatssekretär jeweils anlässlich der Budgetverhandlungen mit ihren Fragen und Vorwürfen.
Der nationalliberale Abgeordnete Alexander Graf Mosle forderte im September 1878 eine stärkere Rolle des Parlaments jenseits der Kommandohoheit, wenn er einen Bericht über das Unglück verlangte, damit der Reichstag anschließend „beschließen kann, ob […] weitere Maßnahmen“ innerhalb der Marine zu treffen seien. Doch Stosch wies solche weitreichenden Forderungen stets zurück, jedoch ohne die Debatte beenden zu können. Denn die publizistische Diskussion schwelte über Monate und Jahre weiter, um jeweils im Vorfeld der Budgetverhandlungen wieder zum Hauptthema zu werden. Stosch trug sich angesichts des öffentlichen und parlamentarischen Drucks mehrfach mit Rücktrittsgedanken, ohne sich jedoch zu diesem Schritt durchringen zu können, da er vermeiden wollte als Feigling dazustehen. Erst im Februar 1880 publizierte die Marine einen schmalen Untersuchungsbericht in den Beiheften des Marineverordnungsblattes, der aber den Liberalen nur als „ein schlechter Kuchen“ galt, „aus welchem alle Rosinen sorgfältig herausgenommen sind.“ Daraufhin trug der linksliberale Abgeordnete Albert Hänel im März eine Rede vor, die argumentativ schon ein Jahr vorher in der entsprechenden Parteirichtungspresse entwickelt worden war. Nach dieser linksliberalen Interpretation der Reichs verfassung hatte Stosch als Stellvertreter des Reichskanzlers, „das konstitutionelle Recht und die konstitutionelle Pflicht, uns […] Rechenschaft zu geben“, ja er wundere sich, dass der Marinechef „seiner verfassungsmäßigen Verpflichtung“ noch nicht nachgekommen sei. Stosch wies diese Interpretation mit Verweis auf höhere Interessen von sich. Der am linken Flügel der Nationalliberalen stehende Eduard Lasker, der schon zuvor damit gedroht hatte, das Budget solange nicht zu bewilligen, bis die liberalen Forderungen nach Aufklärung erfüllt waren, brachte daraufhin einen Antrag ein, der Stosch zwingen sollte, dem Reichstag gefälligst Rede und Antwort zu stehen. Wäre dieser Antrag erfolgreich gewesen, so wäre ein Präzedenzfall geschaffen worden, der gezeigt hätte, dass eine Reichstagsmehrheit entschlossen war, ihren Einfluss auch auf die militärische Sphäre zu erweitern. Militärische Untersuchungen hätten dann nicht mehr ohne Weiteres hinter verschlossenen Türen stattfinden können, ein Verfassungskonflikt wäre die Folge gewesen. Der rechte Flügel der Nationalliberalen allerdings lehnte die „konstitutionelle Spitze“ des Antrags ab und hielt – ebenso wie die katholische Zentrumspartei – die Kompetenzen des Reichstags für überschritten. Aus diesen Gründen kam keine Mehrheit für den Antrag zustande. Die Nationalliberalen sahen eher in einer kritischen Kooperation als im offenen Konflikt mit der Regierung einen Weg, ihre Ziele langfristig zu erreichen. Stoschs liberales Image verhinderte zudem seine völlige Demontage, da immer noch Hoffnungen bestanden, er könne Bismarcks Nachfolger und damit Partner der Liberalen werden.
Nichtsdestotrotz beweist der Antrag, dass nicht alle Liberalen sich mit der Verfassungsordnung des Kaiserreichs und der Sonderrolle des Militärs soweit abgefunden hatten, dass sie keine offensiven politischen Bestrebungen mehr auf diesem Feld entwickelten. Immer noch fanden sich Abgeordnete zum Konflikt mit der Regierung bereit. Gerade die junge Marine und der als nationale Katastrophe breit rezipierte Unglücksfall boten deshalb einen geeigneten Ansatzpunkt, um zu versuchen, den Reichstag als Stimme der Nation aufzuwerten und gegen den Marineminister in Stellung zu bringen. Die Empörung über den fahrlässigen Unfall, die vielen Toten sowie die Peinlichkeit, die frühen Seemachtbestrebungen durch solch eine vermeidbare Katastrophe zurückgeworfen zu sehen, ließ sich nutzen, um verfassungspolitische Fortschritte zu erzielen. Tatsächlich hatte die ganze Sache auch langfristige Konsequenzen, denn Stoschs kooperatives Verhältnis zu den Liberalen war seitdem schwer beschädigt und weder ihm noch seinen Nachfolgern gelang es in beinahe zwanzig Jahren, für größere Flottenrüstungspläne ein positives Votum zu erlangen. Die zweijährige Debatte zeigt aber vor allem, dass der Reichstag sich schon früh als legitimer Vertreter der Nation verstand, der gerade auf dem Feld der Marinepolitik ein gehöriges Wort mitsprechen wollte. Die Ressource Nation, die Stosch angezapft hatte, erwies sich also als zweischneidiges Schwert: Sie wertete einerseits seine Institution auf, bot aber andererseits für die Volksvertretung das Potential, stärkeren parlamentarischen Einfluss zu verlangen. Insgesamt zeigt die Debatte um das Unglück, dass die Frage nach der Parlamentarisierung des Reiches nach wie vor konfliktbehaftet, vor allem aber offen war.
Literatur:
Biefang, Andreas, Die andere Seite der Macht. Parlament und Öffentlichkeit im „System Bismarck“ 1871–1890, Düsseldorf 2009
Langewiesche, Dieter, Bismarck und die Nationalliberalen, in: Gall, Lothar (Hg.), Otto von Bismarck und die Parteien, Paderborn 2001, 73–89
Rojek, Sebastian, Versunkene Hoffnungen. Die Deutsche Marine im Umgang mit Erwartungen und Enttäuschungen 1871–1930, Berlin/Boston 2017
Ders.: Landmilitärische oder seemilitärische Expertise? Transformationen der Legitimationsbasis der Kaiserlichen Marine, ca. 1871–1900, in: Technikgeschichte 86 (2019), 281–296
